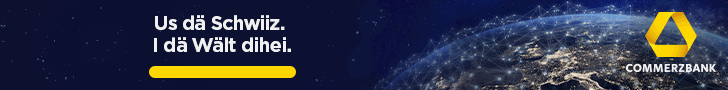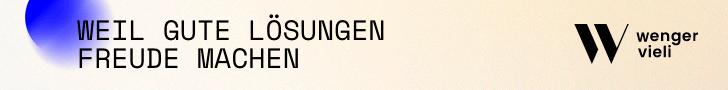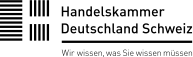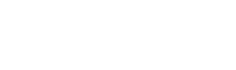Aufsicht in Zeiten digitaler Transformationen
Deutschlands Aufsichtsräte seien «schlecht ausgestattet», «relativ nutzlos» und «alles alte Kerle» – dass das Handelsblatt vor knapp einem Jahr seinen Artikel zu einer gerade vorgelegten Studie der Beratungsfirma Alvarez & Marsal auf diese Weise betitelte, dürfte manchen Leser mindestens irritiert, manchen aber auch direkt empört haben.

Wirtschaft
Wir begleiten Sie auf allen Absatzwegen: nach Deutschland, in die Schweiz oder in das Fürstentum Liechtenstein.
Schon 2017 stellte eine Studie der Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller und des Personalberaters Heiner Thorborg fest, dass 70 Prozent der Aufsichtsräte in Deutschland das Thema «Digitale Transformation» für «sehr wichtig» oder «wichtig» halten, ihre eigenen Kompetenzen aber nur 4 Prozent der Befragten als «sehr hoch» und nur 30 Prozent als «hoch einschätzen».
«Als strategisches Führungsorgan ist es für KMU-Verwaltungsräte unabdingbar, die Implikationen der Digitalisierung für ihre Geschäftsmodelle rechtzeitig zu erkennen und zu nutzen», fassen das Schweizerische Institut für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität St. Gallen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft OBT AG ihr «VR-Symposium 2018» zusammen, und stellen fest, dass «Digitalisierung [...] KMU- Verwaltungsräte vor vielschichtige Herausforderungen [stellt]», da durch eben diese Verwaltungsräte «relevante Trends [...] frühzeitig erkannt und in strategische Handlungsoptionen übersetzt werden [müssen], um auch in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens zu sichern.».
Ende 2018 stellte die Strategieberatung BearingPoint im Hinblick auf die Digitale Transformation der Wirtschaft in Österreich fest: «Nur von ganz oben können Massnahmen angetrieben werden» – und schlug eine «Digitalisierungsquote» für Aufsichtsräte vor.
StartUp-Kultur und Gründungs-erfahrung richten Kontrollorgane auf die digitale Zukunft aus
Um «die unternehmerische Tätigkeit des Vorstands im Sinne einer [primär] präventiven Kontrolle begleitend» kontrollieren zu können, also «die Entstehung von Krankheiten zu verhindern», bietet es sich gerade für mittelständische Unternehmen an, sich der Ressource Gründerinnen und Gründer zu bedienen. Diese haben sich in ihrer Ausbildung und in ihrem Hauptberuf zumeist nicht nur passiv mit den digitalen Transformationen beschäftigt, sondern können praktische Erfahrungen aus eigener Gestaltung mit- und einbringen. Sie können dazu beitragen, das Potential von Diversität, Internationalität und insbesondere auch von Heterogenität der vertretenen Altersgruppen für die Aufsichtsratstätigkeit zu heben.
Die sekundäre Prävention ist auf die Früherkennung von Krankheiten gerichtet. Um in diesem Sinne «die unternehmerische Tätigkeit des Vorstands im Sinne einer [sekundär]präventiven Kontrolle» zu begleiten, bietet sich eine Aufschlauung des Aufsichtsrats an: Wo (noch) keine Gründerinnen und Gründer in die direkte Verantwortung aufgenommen werden sollen oder können, lässt sich möglicher-weise ein Aufsichtsrat-in-Residence- Programm etablieren. Da, wie eingangs erwähnt, 70 Prozent der Aufsichtsräte in Deutschland das Thema «Digitale Trans-formation» für «sehr wichtig» oder «wichtig» halten, und ein Aufsichtsrat grundsätzlich mit der Kompetenz ausgestattet ist, Sachverständige zu beauftragen sowie diese dann zu leiten und zu überwachen, wäre ein solches Programm möglich und wünschenswert. Wo es nicht möglich ist, sollten Gesetzgeber und Regulatoren dies ändern. Eine praktische Nachvollziehbarkeit für ein solches Programm gibt die Harvard Business School, die «Entrepreneurs [who] have founded, sold, or IPO’d successful ventures in tech, consumer products, healthcare, biotech, media and entertainment» als «Entrepreneurs in Residence» einlädt, die dann «come to campus 6-7 times per year to meet with students 1:1 [...] and work with faculty on research and course development.» Die jungen Aufsichtsräte-in-Residence-Teilnehmer stehen mit ihrem Sachverstand und ihren Erfahrungen im Hinblick auf die Digitale Transformation so auch niedrigschwellig solchen Gremien zur Verfügung, die beispielsweise von ihren Wahlen noch weit entfernt sind – und es würden, ganz im Sinne des «Reverse Mentoring», beide Seiten hiervon profitieren.
Jedes Unternehmen sollte handeln – aber eben auch Verbände, Regulatoren, Gesetzgeber
Neben der Aus- und Weiterbildung bedarf es für eine gelingende Verhältnisprävention der in digitaler Transformation befindlichen Wirtschaft auch einer von Anfang an gut gestalteten Stellung der jungen Wilden im Aufsichtsrat, was sich beispielsweise durch die Einführung der Rolle eines Digitalisierungsexperten (analog zum Finanzexperten) und durch die Zurverfü-gungstellung eines Aufsichtsratsbüro für junge Aufsichtsräte bewerkstelligen liesse.