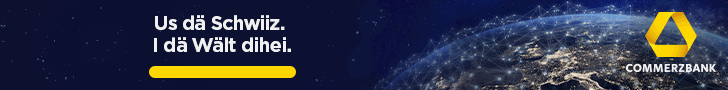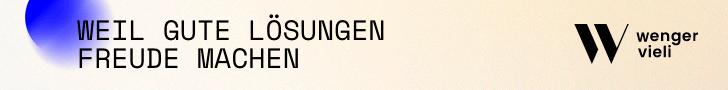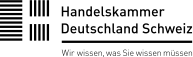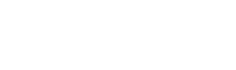Masseneinwanderungsinitiative: Nachhaltige Lösung der Beziehungen Schweiz-EU erforderlich
Über ein Jahr nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative ist eine Lösung zwischen der Schweiz und der EU nicht in Sicht. Unterdessen hat der Bundesrat die Gesetzesvorlage zur Umsetzung des neuen Verfassungsartikels in die Vernehmlassung, mit Frist 28. Mai 2015, geschickt. Da die Vorlage Kontingente für alle Ausländer, inklusive EU Bürger und Grenzgänger vorsieht, ist eine Anpassung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU erforderlich.
Während die Schweiz ein Verhandlungsmandat verabschiedet hat, ist die EU nicht gewillt, Verhandlungen über eine Anpassung aufzunehmen. Damit besteht die Gefahr der Kündigung oder Sistierung der gesamten bilateralen Abkommen I.
Geblieben ist die grosse Verunsicherung bei deutschen und schweizerischen Unternehmen über die Frage, welches Regelwerk und welches künftige Integrationsniveau zwischen der Schweiz und der EU zu erwarten ist. Diese Frage wird der Handelskammer heute beinahe täglich von den am grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr beteiligten Firmen gestellt. Dabei stehen Befürchtungen um eine allfällige Personalknappheit und deren Auswirkung auf die Erfüllung von Aufträgen, den weiteren freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen sowie die Auswirkungen auf geplante Investitionen im Vordergrund.
Deutschland ist Wirtschaftspartner Nr. 1 für die Schweiz mit einem Handelsvolumen von 90 Mrd. CHF. Produkte und Dienstleistungen, auch im Rahmen von Wertschöpfungsketten, überqueren heute täglich die Landesgrenzen. Leben und arbeiten im jeweils anderen Land, studieren, Aufträge ausführen, Montagen vornehmen, gemeinsam kooperieren in Forschung und Entwicklung, entsenden von Mitarbeitenden, an firmeninternen Schulungen und Projekteinsätzen teilnehmen, Messen besuchen und ausstellen, im Verkauf akquirieren und vieles mehr, sind heute eine Selbstverständlichkeit zwischen den beiden Wirtschafts-partnern. Dieser reibungslose Austausch über die Grenze stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte im globalisierten Wettbewerb. Die Basis und Voraussetzung hierfür stellt das Rahmenwerk der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU dar.
Im Falle der Kündigung der bilateralen Abkommen wäre aus Sicht der Handelskammer der Wirtschaftsverkehr zwischen beiden Ländern erheblich beeinträchtigt. (siehe Kasten) – zum Nachteil für die Schweiz und für Deutschland.
Angesichts der unsicheren Ausgangslage ob einer Verhandlungslösung und dem beträchtlichen Schaden der bei einer Kündigung der Abkommen drohen würde, begrüsst die Handelskammer Deutschland-Schweiz ausdrücklich die Initiative der Spitzenverbände der schweizerischen Wirtschaft, den Vorschlag eines flexiblen Migrationsmodells mit Schutzklauseln in die Gespräche mit der EU einzubringen.
Dass parallel zu den Bemühungen um eine Verhandlungslösung mit der EU bereits Verhandlungen zu einem institutionellen Rahmenabkommen stattfinden, ist sehr förderlich.
Es gilt so schnell wie möglich die Planungssicherheit für die Unternehmen wieder herzustellen. Dazu ist es erforderlich, dass die Beziehungen Schweiz-EU auf ein langfristig zuverlässig kalkulierbares und nachhaltiges Fundament gestellt werden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Die bilateralen Abkommen sind eine Erfolgsgeschichte
Die bilateralen Abkommen sind für die Wirtschaft Deutschlands und der Schweiz seit ihrem Bestehen eine Erfolgsgeschichte. Grundsätzlich gehen Ökonomen des SECO davon aus, dass die Öffnung der Märkte und somit der Austausch und die Verflechtung für die beteiligten Volkswirtschaften von Vorteil ist. Forscher der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) stellen fest, dass seit dem Inkrafttreten der Bilateralen I die Wachstumsrate der Schweiz deutlich gestiegen ist. Die Schweiz hat im 2014 Waren im Wert von 128 Mrd. CHF in die EU exportiert, dies entspricht einer Zunahme von 32% im Vergleich zu 2001. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos hat anhand eines Simulationsmodells das Wachstum der Schweizer Wirtschaft seit Einführung der Bilateralen I geschätzt und kommt zum Schluss, dass rund ein Drittel des heutigen Wohlstands der Schweiz auf die positive Entwicklung des Austausches mit der EU zurückzuführen ist. Schweizer Exporteure konnten von den bilateralen Verträgen klar profitieren.
Warenverkehr
Der Warenverkehr Schweiz-EU wird vor allem durch das Freihandelsabkommen von 1972 geregelt. Dieses ist nicht Bestandteil der bilateralen Verträge I und wäre auch nicht direkt von der Kündigung des Freizügigkeitsabkommens betroffen.
Indirekte Auswirkungen auf den Warenverkehr könnten sich aber dann ergeben, wenn eine Warenlieferung mit einem Dienstleistungsanteil verbunden ist und dieser von einer Kündigung des Freizügigkeitsabkommens betroffen wäre. Weitere indirekte Auswirkungen auf den Austausch von Gütern im Kündigungsfall der bilateralen Verträge wären durch den Wegfall der Abkommen über technische Handelshemmnisse sowie des öffentlichen
Beschaffungswesen gegeben.
Durch das Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen erhalten Unternehmen aus der Schweiz bzw. der EU die Möglichkeit, gleichberechtigt an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen und damit eine weitere Marktchance zum Absatz ihrer Güter und Dienstleistungen durch die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen. Ein Wegfall des Abkommens über technische Handelshemmnisse würde für Exportunternehmen voraussichtlich zu höheren Kosten und längeren Wartezeiten bei dem Export von Waren führen. Zum Beispiel müssten Schweizer Produkte ohne eine gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertung für einen Export in die EU einer doppelten Konformitätsbewertung unterzogen werden. Zwar würden bestehende Konformitätsbewertungen weiterhin anerkannt. Betroffen wären aber künftige Konformitätsbewertungen, um die nach der Kündigung des Abkommens ersucht würde. Da dies sehr weite Bereiche des Warenverkehrs im Investitionsgüter- und Gebrauchsgütersektor zwischen Deutschland und der Schweiz treffen würde, wären die Auswirkungen erheblich.
Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr und Bauwirtschaft
Das vor allem den Dienstleistungsverkehr betreffende Schweizer Entsendegesetz gilt, solange das Freizügigkeitsabkommen in Kraft ist. D.h. solange das Freizügigkeitsabkommen weiterhin seine Geltung hat und keine der Parteien eine Kündigung des Abkommens ausspricht, gelten die bisherigen Regelungen für Entsendebetriebe weiter. Im Falle einer Kündigung würde diese gesetzliche Grundlage entfallen. Wie eine neue Regelung aussehen würde, lässt sich nicht voraussagen.
Personenfreizügigkeit
Im Falle einer Kündigung des Freizügigkeitsabkommens blieben zwar die bereits erworbenen Rechte einzelner Personen bestehen. So wären die bereits erteilten Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen weiterhin gültig.
Eine Kündigung des Abkommens hätte aber massiven Einfluss auf die Möglichkeit, Personal im Ausland zu akquirieren. Neben einer zahlenmässigen Beschränkung durch Kontingente wäre die grenzüberschreitende Zuwanderung von Arbeitnehmern durch zwei weitere Aspekte betroffen: zum einen hätte der Wegfall des Personenfreizügigkeitsabkommens Auswirkungen auf die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen. So erfolgt heute unter dem Abkommen bei reglementierten Berufen eine automatische Anerkennung oder zumindest ein erleichterter Berufszugang. Zum anderen schafft das Freizügigkeitsabkommen auch eine Koordinierung bei der sozialen Sicherheit, was erhebliche Vorteile für die einzelnen betroffenen Personen bedeutet (so z. B. durch Festschreibung eines Gleichbehandlungsgebotes, Leistungsexport oder Anrechnung von ausländischen Versiche-rungszeiten).
Nutzen Sie die Vorteile der Mitgliedschaft